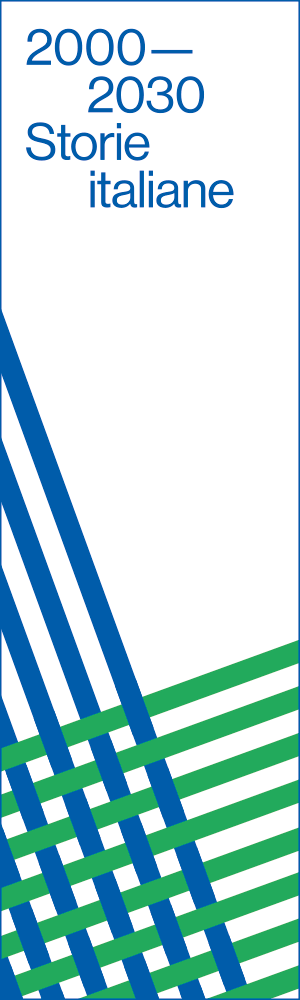Die Veränderungen durch den Bologna-Prozess haben nicht nur Bachelor- und Masterstudien betroffen, so stol.it. Auch das Doktorat hat sich in den vergangenen Jahren strukturell gewandelt, so sagte die Vizerektorin der Uni Agram (Zagreb), Melita Kovacevic, am Donnerstag bei den Hochschulgesprächen beim Forum Alpbach, vom traditionellen „Meister-Schüler-Prinzip“ hin zu einem System mit „verantwortlichen Institutionen“.
Rund 85 Prozent der europäischen Hochschulen haben mittlerweile „Doctoral Schools“ eingerichtet. Diese führen die Doktoranden in einem strukturierten Programm zum Abschluss und in die Forschung, so betonte Kovacevic, die auch in der European University Association (EUA) das Thema Doktorat betreut. Gleichzeitig braucht es aber eine gewisse Diversität: „Auch im gleichen Doktoratsprogramm sollen die Studenten nicht das gleiche Curriculum haben, sie sollen durchaus andere Lehrveranstaltungen besuchen.“ Eine gute „Doctoral School“ dauert drei bis vier Jahre, weist eine Abschlussrate um die 90 Prozent auf und leitet die Studenten an, einen erfolgreichen Beitrag zur Forschung zu leisten.
Einen Drei-Schichten-Ansatz verfolgt der Hochwasserexperte und Leiter eines vom Wissenschaftsfonds FWF geförderten Doktoratsprogramms mit 30 Studenten, Günter Blöschl (TU Wien). In diesem Programm sollen die Studenten unterschiedlicher Fachrichtungen als Team lernen. „Wir wollen individuelle Forschung ohne Fachgrenzen fördern.“ Vertreten sind etwa Mathematiker, Geologen und Sozialwissenschaftler.
Die erste Schicht umfasst die Schaffung gemeinsamer Büros, die zum gegenseitigen Austausch anregen sollen. Zweitens sollen die Wissenschaftler an verwandten wissenschaftlichen Fragestellungen arbeiten, so arrangiert man etwa regelmäßig Cluster-Meetings mit acht bis zehn Studenten, die bestimmte Themen wie etwa Überschwemmungen transdisziplinär diskutieren. Und drittens betreibt man an den gleichen Orten gemeinsame Feldforschungen. Dieser Ansatz erlaubt die Bearbeitung komplexerer Forschungsthemen und zwingt die Studenten zum Teamwork, so Blöschl.
Die Uni Wien gehört noch zu den restlichen 15 Prozent ohne „Doctoral School“, so Vizerektorin Susanne Weigelin-Schwiedrzik. Die Universität weist derzeit 10.000 Doktorratsstudenten auf. „Aber nur 3.000 bis 4.000 verfolgen aktiv ihr Projekt. Vom Rest wissen wir nicht, was sie tun, nur dass sie jedes Semester zurückkommen und sagen, sie wollen Doktoratsstudenten bleiben.“ Das Problem ist dass die Studenten selbst entscheiden könnten, ob sie ein Doktoratsstudium betreiben wollen. Die Uni hat keine Möglichkeit zur Auswahl, außer bei Programmen des Wissenschaftsfonds FWF.
Rund 1700 Doktorratsstudenten der Uni Wien verfügen über eine Art Beschäftigungsverhältnis mit der Uni. Ziel ist es, hier auf 2000 zu kommen, so Weigelin-Schwiedrzik. Außerdem hat man ein kompetitives Scholarship-Programm gestartet, für das sich Studenten um eine dreijährige Förderung, etwa für Konferenzteilnahmen etc., bewerben können. Dieses ist mit 6000 Euro pro Jahr dotiert.
Uni Wien will “keine Schüler, sondern Wissenschaftler” Statt Doctoral Schools plant die Uni Wien acht „Doctoral Academies“: „Wir wollen keine Schüler, sondern Wissenschaftler“, betonte die Vizerektorin. Diese sollen nicht auf ein spezifisches Fach ausgerichtet, sondern auf mehr als einen Gegenstand und transdisziplinär angelegt sein. Eine Academy soll zwischen 50 und 100 Mitglieder haben und 120.000 Euro erhalten.
Gemeinsames Problem aller Doktoratsansätze ist die finanzielle Unterstützung, ortete die Vizerektorin der Akademie der bildenden Künste, Andrea Braidt. Die Mehrzahl der Doktoratsstudenten werden nach wie vor nicht angestellt oder finanziell gefördert. „Das hat negative Auswirkungen auf die Forschung: Viel Potenzial wird so nicht genützt.“
Ähnlich sah es Kovacevic: Doktoranden müssen als Wissenschaftler angesehen werden, egal ob sie in Schools, Academies oder individuell forschten. „Deshalb müssen sie entsprechend bezahlt oder gefördert werden.“